|
 |
|
Wegweiser |
|
|
|
letzte Aktualisierung:
Samstag, 22. Februar 2014
Anschrift:
Kulturwerk Neckar-Alb
Postfach 1624
72606 Nürtingen
Infotelefon: 0176-85270515
JÜNGSTE VERANSTALTUNG:
- 29. Oktober 2011 - Ahnengedenken statt Halloween
kommende Veranstaltungen 2012:
24. März 2012
Frühlingsfest/Winteraustreiben - Frühjahrstag- und Nachtgleiche
|
|
|
|
|
|
 |
|
Tübingen: Denkmalstreit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Wandel der Erinnerungskultur und des Gedenkens
am Beispiel des ehemaligen
Denkmals der 78. Infanterie/Sturmdivision
in Tübingen
 Seit 1995 das Hamburger Institut für Sozialforschung unter der Leitung von Jan Phillip Reemtsma seine Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ in deutschen und österreichischen Städten präsentierte, hat sich das öffentliche Verhältnis zur deutschen Wehrmacht gewandelt. Die Ausstellung löste eine Kontroverse aus. Die Streitgespräche fanden auf verschiedenen Plattformen statt. Hauptagitationspunkt war die Presselandschaft, in der eine Leserbriefdebatte vom Zaun brach. Ehemalige Wehrmachtssoldaten fühlten sich teilweise von der Ausstellung verleumdet und beanstandeten insbesondere eine Pauschalisierung von Wehrmachtsverbrechen und die, der Ausstellung innewohnende, Grundthese, welche besagen würde, dass die Verbrechen von der gesamten Institution Wehrmacht begangen worden wären. Seit 1995 das Hamburger Institut für Sozialforschung unter der Leitung von Jan Phillip Reemtsma seine Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ in deutschen und österreichischen Städten präsentierte, hat sich das öffentliche Verhältnis zur deutschen Wehrmacht gewandelt. Die Ausstellung löste eine Kontroverse aus. Die Streitgespräche fanden auf verschiedenen Plattformen statt. Hauptagitationspunkt war die Presselandschaft, in der eine Leserbriefdebatte vom Zaun brach. Ehemalige Wehrmachtssoldaten fühlten sich teilweise von der Ausstellung verleumdet und beanstandeten insbesondere eine Pauschalisierung von Wehrmachtsverbrechen und die, der Ausstellung innewohnende, Grundthese, welche besagen würde, dass die Verbrechen von der gesamten Institution Wehrmacht begangen worden wären.
Es tat sich ein Wandel in der Erinnerungskultur der deutschen Öffentlichkeit bezüglich der Wehrmacht auf.
Direkt verbunden mit der Reemtsma-Ausstellung und dem dadurch ausgelösten Wandel in der Erinnerungskultur war eine Meinungsdebatte in Tübingen, welche im Endeffekt mit der Entfernung eines Denkmals für die 78. Infanterie/Sturmdivision endete. Die Ausstellung förderte Belege zu Tage, dass auch die 78. Division bei Ihrem Rückzug aus Russland an Hitlers Politik der verbrannten Erde beteiligt war.
Das ehemals in Tübingen befindliche Denkmal der 78. Infanterie/Sturmdivision und der Umgang mit diesem stellt ein greifbares Beispiel für den Wandel der Wahrnehmung der Wehrmacht dar und ist damit auch ein Beispiel für den Umgang der NS-Vergangenheit an sich.
Im Folgenden ist zunächst die Frage angeschnitten, was überhaupt ein Denkmal ist. Im Weiteren ist erörtert, was „Erinnerungskultur“ bedeutet. Es schließt sich eine Definition von Kriegerdenkmälern an.
Anhand der Beschreibung des Umgangs mit dem Kriegerdenkmal der 78. Infanterie/Sturmdivision soll exemplarisch dargestellt werden, wie sich das Gedenken an die Wehrmachtsangehörigen bzw. die Wahrnehmung dieser verändert hat.
1. Was ist ein Denkmal?
Was ist ein Denkmal? – Diese, auf den ersten Blick banal wirkende Fragestellung, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Fragestellung, die erstens tief greifende und zweitens komplexe Antworten zulässt.
Unter einem Denkmal kann ein in der Öffentlichkeit errichtetes und für die Dauer
bestimmtes Werk verstanden werden, das an Menschen oder Ereignisse erinnern soll „und auch aus dieser Erinnerung einen Anspruch seiner Urheber, eine Lehre oder einen Appell an die Gesellschaft ableiten oder begründen soll“
So erkennt man den Geist einer Epoche am besten an den Denkmälern, die sie
hervorgebracht hat. Ein Denkmal ist im engeren Sinne ein zur Erinnerung errichtetes Werk der Architektur oder Bildhauerei, ein Werk also, „das natürlicherweise stark mit Emotionen (Erinnerung, Trauer, Mahnung) verbunden ist und darum leicht zum Kitschigen neigt.“
Denkmale bilden folglich Marksteine, in denen die Menschen Symbole schufen für ihre Ideale, ihre Ziele und ihre Handlungen. Sie sind dazu bestimmt, „die Epoche zu
überdauern, in der sie entstanden und stellen ein Vermächtnis an die zukünftigen
Generationen dar. Sie formen ein Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft.“
Ein Denkmal zielt somit auch auf die nachfolgenden Generationen ab, eben in dem Sinne, um einzelne menschliche Taten oder Geschicke im Bewusstsein der nachlebenden Generation stets gegenwärtig und lebendig zu erhalten. „Es kann entweder ein Kunstdenkmal oder ein Schriftdenkmal sein, je nachdem es das zu verewigende Ereignis mit den bloßen Ausdrucksmitteln der bildenden Kunst oder unter Zuhilfenahme einer Inschrift dem Beschauer zur Kenntnis bringt; am häufigsten sind wohl beide Gattungen gleichwertig miteinander vereinigt.“
2. Erinnerungskultur und Gedenken
Grundlage für die Erinnerungskultur ist das Geschichtsbewusstsein, denn dieses macht das Erinnern überhaupt erst möglich. Als Geschichtsbewusstsein wird gemeinhin „die Art, in der die Vergangenheit in Vorstellung und Erkenntnis gegenwärtig ist“ bezeichnet. Das Geschichtsbewusstsein ist also nicht bloßes Wissen über Geschichte, sondern es meint das Zusammenbringen von Vergangenem mit der Situation der Gegenwart und den Perspektiven für die Zukunft.
Als Erinnerungskultur bezeichnet man „den mehr oder weniger reflektierten Umgang mit Ereignissen und Zusammenhängen der Vergangenheit“, der es besonders darum geht, dass „diese Erinnerungen in einem lebendigen Bezug zu einer konkreten Person oder Gruppe in der Gegenwart stehen, die sich als Teil dieser Geschichte begreift.“ Im Zentrum steht dabei in erster Linie die subjektive Wahrnehmung historischer Zusammenhänge aus einer aktuellen Perspektive, weniger die Darstellung historisch-objektiven Wissens. Es kann zwischen einer privaten und einer öffentlichen Erinnerungskultur unterschieden werden. Am Beispiel der jüdischen Religion, die stark von den Begriffen Erinnerung und Gedächtnis geprägt ist, lässt sich recht deutlich machen, was „Erinnern“ meint: An jedem Paschafest erinnern sich die Juden an ihre Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens durch Gott und gleichzeitig besinnen sie sich auf ihre dadurch entstandenen Werte und Normen, die noch immer gültig sind. Es entsteht eine Verbindung von Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem, die dieser Religion eine Struktur gibt, die ihre Mitglieder sowohl mit der Zeit (durch den gemeinsamen Vergangenheitsbezug) als auch untereinander verbindet.
Gedenken gilt auf der einen Seite als besondere Form des Erinnerns, als ein spezifischer Modus des kollektiven Gedächtnisses, des sozialen Gedächtnisses oder auch als Form der Erinnerungskultur. Es handelt es sich bei diesen Art und Weisen des Beschreibens von Gedenken um idealtypische Konzepte. Auf der anderen Seite wird Gedenken als politisches Ritual, im weiteren Sinne der politischen Festkultur, definiert und ist insofern Gegenstand der politischen Kulturforschung.
3. Was ist ein Kriegerdenkmal?
Der Begriff Kriegerdenkmäler wird oft zusammenfassend für alle Denkmäler und Denkstätten mit militärischen Zusammenhängen gebraucht. Inbegriffen sind dabei die Soldatenfriedhöfe oder einzelne Soldatengräber. Diese sind eher als Friedhöfe und Grabdenkmäler zu betrachten, nicht jedoch als Kriegerdenkmäler. Zwar gibt es mitunter Verknüpfungen, z. B. wenn ein Kriegerdenkmal auf einem Friedhof steht, dennoch ist ein Kriegerdenkmal als solches keine Grabstätte oder mit einer solchen verbunden.
Die Kriegerdenkmäler an sich lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe umfasst alle Denkmäler in Erinnerung an Schlachten, Gefechte und Heerführer, sprich an Geschehnisse und überragende Personen. In ihrer Mehrzahl sind sie im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert entstanden. Zu ihnen zählen zunächst die Nationaldenkmäler. Weiterhin umfasst diese Gruppe alle Denkmäler für Schlachten und Gefechte vom Bauernkrieg über den Dreißigjährigen Krieg, den Siebenjährigen Krieg bis hin zu den zahlreichen Denkmälern in Erinnerung an die Befreiungskriege. Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sei als Beispiel genannt. Sie sind nicht selten von namhaften Bildhauern geschaffen worden oder nehmen eine hervorragende Rolle im Stadtbild ein und haben somit hohen kulturhistorischen Wert. Je nachdem wie sehr die Person oder das Ereignis in die Traditionspflege des jeweiligen Systems passte, wurden die jeweiligen Denkmäler gepflegt, geehrt oder genutzt.
Die zweite Gruppe der Kriegerdenkmäler, umfasst die regionalen Kriegerdenkmäler zum Gedenken an die Gefallenen, Soldaten wie Offiziere, in den Kriegen. Sie treten zahlenmäßig am häufigsten auf und finden oder fanden sich in fast jedem Ort. Charakteristisch für sie ist ihr regionaler Bezug. In der Regel sind auf diesen Denkmälern die Gefallenen des Ortes oder der Gemeinde namentlich genannt. Weiterhin wurden Kriegerdenkmäler von Mitarbeitern vorrangig staatlicher Institutionen für ihre gefallenen Kollegen gestiftet. Es gibt Denkmäler und Denktafeln in Schulen und Seminaren für gefallene Lehrer und Schüler, für kommunale und staatliche Bedienstete wie Straßenbahner, Eisenbahner und Förster, um nur einige Beispiele zu nennen.
Einen Sonderfall stellen die Regimentsdenkmäler dar, die von einzelnen Regimentern oder Truppenteilen zum Gedenken an die Gefallenen des Regiments aufgestellt wurden. Zwar sind oftmals auch die die Gefallenen namentlich verzeichnet gewesen, doch sind diese Denkmäler einerseits überregional und andererseits gleichzeitig Memorialdenkmäler für die Regimenter. Eines von diesen war das Kriegerdenkmal für die 78. Infanterie/Sturmdivision in Tübingen.
Kriegerdenkmale, die nicht nur an Heerführers oder Offiziere erinnern, sondern auch an einfache Soldaten, entstanden erst in der Neuzeit, genauer seit der französischen Revolution und den Koalitionskriegen. Damals wurde die Kriegführung durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht radikalisiert und gleichzeitig vergesellschaftet. Erstmals war die breite Masse der Völker vom Krieg betroffen; für die sich über mehr als 15 Jahre hinziehenden Koalitionskriege wurde eine bislang unvorstellbare Zahl von Soldaten mobilisiert. Das Wehrpflichtsystem begünstigte eine rücksichtslose Kriegführung mit riesigen Verlusten, bis zur Erschöpfung aller Beteiligten. Die Ideale der französischen Revolution spiegelten sich also auch in der erstmaligen Erwähnung der Namen einfacher Soldaten auf Gedenktafeln und Denkmälern wider; der „Bürger“ war „Soldat“ geworden.
Kriegerdenkmale erzählen mehr und authentischer über diejenigen, die sie errichten, als über jene, derer gedacht wird. Es sind die Überlebenden oder Nachgeborenen, die das Schicksal und Vermächtnis der Toten deuten.
Die Funktion eines Kriegerdenkmals ist vielfältig. Es soll die Angehörigen trösten, indem es dem Tod ihrer Verwandten einen Sinn verleiht, es soll die Überlebenden auf das Vorbild der Opfer verpflichten und den Staat und seine Ideale repräsentieren. Deshalb gab es um die Aufstellung von Kriegerdenkmalen auch häufig Konflikte. Verschiedene gesellschaftliche Gruppen versuchten mit dem Denkmal, ihre Deutung des Krieges oder der Gesellschaft durchzusetzen. Etwa, ob nun die Trauer um die Toten oder eher Heldenverehrung (bisweilen mit Ausdruck des künftigen Willens zur Revanche) im Vordergrund stehen sollte. Rückschlüsse darauf sind bisweilen aus dem Widmungstext des Denkmals zu ersehen.
4. Denkmalsstreit in Tübingen
4.1 Die 78. Infanterie/Sturmdivision und deren Kameradenhilfswerk
Die Geburtsstunde der 78.Infanteriedivision war der 26. August 1939. In den ersten beiden Jahren des Krieges befand sich die Division in Reserve, was meint, dass sie weder am "Überfall auf Polen" noch am Krieg gegen Frankreich beteiligt war. Ins Kampfgeschehen wurde sie erst im Zuge des Russlandfeldzuges einbezogen. Ende 1942 bekam die Division den Ehrentitel Sturmdivision, da sie beim Vormarsch auf Moskau meist direkt an der Front kämpfte und große Erfolge erzielte. Sie ist eine der Divisionen, die bis kurz vor Moskau gelangten, aber aufgrund des Winters und der russischen Übermacht zum Rückzug gezwungen werden.
Nach der ersten Wiedersehensfeier 1952 in Tübingen gründeten ehemalige Divisionsangehörige das „Kameradenhilfswerk der ehemaligen 78. Infanterie-Sturmdivision“. Das Kameradenhilfswerk machte sich zur Aufgabe Witwen gefallener Divisionskameraden und Schwerkriegsbeschädigte zu unterstützen. Des Weiteren sollte es der Pflege der Kameradschaft dienen und eine Institution zur Pflege militärischer Tradition sein.
4.2 Die Einweihung des Denkmals
Das Denkmal für die Toten und Gefallenen der 78. Infanterie-Sturmdivision mit der Aufschrift „Ihren toten und gefallenen Kameraden – Die 78. Infanterie-Sturmdivision 1939 - 1945“ wurde im Zuge der sog. „4. Wiedersehensfeier der ehemaligen Angehörigen der 78. Sturmdivision“ am 10. und 11. Oktober 1959 eingeweiht. Enthüllt wurde es vom damaligen Oberbürgermeister Hans Gmelin, selbst einst Leutnant innerhalb der Sturmdivision und Ehrenvorsitzender selbiger bis zu seinem Tode im Jahr 1991. Er Sprach von Söhnen, die ihr Leben für das Vaterland gaben und nahm das Denkmal in die „Obhut der Universitätsstadt Tübingen“. In den Reden ist kein Hinweis auf eventuelles Unrecht, kein deutlicher Hinweis auf die Unrechtmäßigkeit des Krieges an sich zu finden. So heißt es im Vorwort der Einladungsbroschüre zur 4. Wiedersehensfeier: „ [...] Zum Gedenken an die vielen Gefallenen der 78. Sturmdivision wird die Einweihung des Gedenksteins uns alle in einer schlichten Feier vereinigen. Die Universitätsstadt wird diesen Gedenkstein gerne in ihre Obhut nehmen, weil viele Söhne unserer Stadt mit der 78. Sturmdivision ausgezogen sind, in ihren Reihen gekämpft und ihr Leben für das Vaterland gegeben haben. […]“
Als Schirmherr dieser 4. Wiedersehensfeier fungierte der Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger.
Der Stein auf der Neckarinsel entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem zentralen Wallfahrtsort der ehemaligen Frontkämpfer aus der ganzen Region. Es entstand mit der Zeit eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Stadt Tübingen und dem „Kameradenhilfswerk“. Nicht nur Gmelin verfasste Grußworte, auch dessen Nachfolger tat ihm gleich. Des Weiteren legte die Stadt immer am Vorabend zum Volkstrauertag einen Kranz am Denkmal nieder.
4.3 Der Meinungsstreit um das Denkmal
Im Jahre 1995 tauchten Dokumente über Kriegsverbrechen der 78. Sturmdivision auf. Es handelt sich um sog. Vollzugsberichte, die über die Anwendung der „Taktik der verbrannten Erde“ , welche die Division während eines Rückzuges im Jan. 1942 anwendete, berichten. Nach diesen Dokumenten sind russische Dörfer zerstört und deren Bewohner schutzlos der Kälte preisgegeben worden. Im Mai 1995 berichtete das „Schwäbische Tagblatt“ über diese Zerstörungsaktionen, was zu einer öffentlich geführten Kontroverse über die Zusammenarbeit von der Stadt Tübingen und dem „Kameradenhilfswerk“ führte.
Diese Verbrechen waren nicht die einzigen der 78. Im Jahr 2000 wurden weitere Verbrechen an der Zivilbevölkerung durch einen Akten-Fund bekannt. Darin ist vermerkt, dass die 78. zu Beginn des Jahrs 1944 weißrussische Männer, Frauen und Kinder als menschliche „Minensuchgeräte“ einsetzte. In einem Kommandeursbefehl ist zu folgendes zu lesen: „Ich befehle daher, dass Wege, die von deutschen Truppen befahren werden müssen, täglich von sämtlichen Ortseinwohnern (einschl. Frauen und Kindern) mit Kühen, Pferden und Fahrzeugen bis zur nächsten Kommandantur zuerst abgetrampelt werden.“
Das Bekannt werden dieser Verbrechen löste eine öffentliche Kontroverse aus. Speziell über Leserbriefe wurde dieser Meinungsstreit ausgeführt. Die Meinungen gingen stark auseinander. Während die einen Abriss des Denkmals forderten, meinten andere, man solle die Aktivität der Stadt (im Grunde die Kranzniederlegung am Volkstrauertag) einschränken. Wiederum andere sahen das Gedenken an die Gefallenen der Sturmdivision als richtig an. Selbst in dieser Meinungsrichtung gab es Unterschiede. Die einen vertraten die Meinung, dass es nun mal auch Tote seien, derer man gedenken sollte, egal was sie gemacht haben oder nicht gemacht haben, und die anderen meinten, die Soldaten der Wehrmacht hätten nicht zuletzt auch „für uns“ heute gekämpft, weshalb ihrer zu gedenken sei.
Wie sah es nebst den Leserbriefen mit öffentlich geäußerten Meinungen aus?
Die ersten geäußerten Gedanken der Bürgermeisterin Gabriele Steffen gingen dahin, die alljährlichen Kranzniederlegungen zu überdenken. Sie wandte sich deutlich dagegen, die deutschen Soldaten als Opfer zu bezeichnen. „Das klingt so als hätte das Sterben einen Sinn gehabt“, meinte sie. Deutlicher als die Bürgermeisterin wurden die Interessensverbände Zentralamerika-Komitee (ZAK), das Antifaschismus-Komitee und die Informationsstelle Militarisierung (IMI). Sie verhüllten das Denkmal mit einem Spruchband, das die Aufschrift „Denk-mal“ trug. Daneben wurde ein Transparent mit dem Spruch „Wir erinnern an die Verbrechen der 78. Sturmdivision“ den dreißig Besuchern dieser Aktion präsentiert. Sie forderten ein Ende des Gedenkens an die Toten. Nebenbei sprachen sie sich auch für die Abschaffung der Bundeswehr aus. Des Weiteren wurde von Jens Rüggeberg vom Antifa-Komitee ein Ideenwettbewerb vorgeschlagen, wie das Denkmal umgestaltet werden könne, damit die Verbrechen der Division öffentlich würden.
Dieser Vorschlag wurde kurz darauf von einer personell unbekannten Gruppe zu ernst genommen, indem sie in einer nächtlichen Aktion die Tafel des Gedenksteins entfernte und stahl. Einen Teil dessen, in Form eines rotlackierten Sternes, schickten sie bald darauf dem Schwäbischen Tagblatt zu – inklusive eines Bekennerschreibens, in dem sie sich als „Junge Pioniere der Roten Armee/Fraktion Tübingen“ bezeichneten. Sie verlangten, den roten Stern am Denkmal anzubringen, um damit dem „antifaschistischen Widerstand der roten Armee“ gegen den deutschen Einmarsch in Russland zu gedenken.
Nach diesem Vorfall sah sich der Oberbürgermeister bemüßigt Stellung zu nehmen und meinte, es sei für ihn „naiv oder hinterhältig, um nicht zu sagen ungeheuerlich, nunmehr ein totales Verdammungsurteil über ganze Wehrmachtseinheiten und kollektiv über alle ihre Angehörigen zu fällen“. Und weiterhin meinte er: „Was die Denk-Mal-Aktionisten systematisch angezettelt und heuchlerisch begleitet haben, ist einfach eine Schande. (…) Ich empfinde die Arroganz dieser Nachgeborenen verletzend, ja unerträglich. Die Inszenierung lässt jede Achtung vor dem humanen Erbe aller Kulturen vermissen, nämlich der Toten, auch der Toten eines Krieges, in trauernder und wo nötig mahnender Würde zu gedenken.“
Als Antwort unter anderem auch darauf darf man die Beschreibung des Wollens des Mitinitiatoren der Denkmalverhüllung Jens Rüggeberg in seinem Aufsatz „ Streit um ein Denkmal – Streit um das Gedenken“ verstehen. So schreibt er: „Den Initiatoren der Tübinger Manifestation vom 1. September 1996 geht es darum, dieses Verherrlichen [vorhergehend meint er, dass Kriegerdenkmäler den Tod als Opfer, Heldentum und Tugend verherrlichen würden – Anm. d. V] unmöglich zu machen; dabei dient ihnen die St. Johannisgemeinde in Hamburg-Altona als Vorbild, deren Kirchenvorstand die Umgestaltung des gemeindeigenen Kriegerdenkmals aus den zwanziger Jahren beschloss.“ Jens Rüggeberg zitiert nachfolgend die Erklärung des Kirchenvorstandes: „Durch die Umgestaltung muss erreicht werden, dass das Denkmal nie wieder als Ermutigung für militaristisches und nationalistisches Denken und Handeln in Anspruch genommen werden kann.“
4.4 Der Abzug des Denkmals
Das Ende des Denkmals ging in Tübingen fast unbemerkt über die Bühne. Veteranen der 78. Infanterie-Sturmdivision verlegten im August 1999 den Stein in ein Privatmuseum auf dem ehemaligen Bundeswehrtruppenübungsplatz bei Münsingen auf der Schwäbischen Alb. Als Grund für Ihren letzten Rückzug nannten die Veteranen, dass Tübingen sie nicht mehr haben wolle. Deutlich geworden wäre ihnen das aufgrund der Denkmal-Verhüllung, des Diebstahls der Tafel, auch aufgrund, ihrer Meinung nach, unschöner Berichte in der Zeitung über ihre Treffen sowie aufgrund der „unhaltbaren Vorwürfe gegen die Division“ (Äußerung eines Tübingers, ehemals Kompaniechef innerhalb der 78.). Mittlerweile kümmert sich der Traditionsverband Altes Lager Münsingen um die Hinterlassenschaften der 78., unter anderem eben auch um das Denkmal – wieder versehen mit einer Tafel mit altem Spruch: „Ihren toten und gefallenen Kameraden – Die 78. Infanterie-Sturmdivision 1939 – 1945“.
5. Schlussbetrachtung
Tübingen hat ein Denkmal verloren, das zunächst eine Selbstverständlichkeit, gar eine allgemeine Verpflichtung, im öffentlichen Bewusstsein Tübingens darstellte; dann aber mit der Zeit zum Stein des Anstoßes wurde. Mitte der 90er Jahre, wie weiter oben beschrieben, entbrannte eine Kontroverse, die Ihre Höhepunkte in zwei öffentlichen Manifestationen hatte und letztendlich die Entfernung des Denkmals herbei zwang.
Dieser Vorgang ist beispielhaft für den Umgang mit dem Gedenken. Zunächst beispielhaft hinsichtlich eines grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandels als auch hinsichtlich des unterschiedlichen Umgangs der „Erlebnisgeneration“ auf der einen Seite und der nachfolgenden Generationen auf der anderen Seite mit dem Gedenken der Vergangenheit.
Bis in die achtziger Jahre hinein war es nahezu verpflichtend, sich vor den Denkmälern der gefallenen Soldaten der deutschen Armee an den jeweiligen Gedenktagen zu verneigen. Kritik wurde aufs schärfste missbilligt, an Verbrechen wollte man nicht denken. Der Mythos der sauberen Wehrmacht wurde eisern am Leben erhalten. Die Wortwahl von Großadmiral Karl Dönitz im letzten Wehrmachtbericht vom 9. Mai 1945, die den Kampf der Wehrmacht als „heldenhaft“ und „ehrenvoll“ beschrieb, hatte langzeitliche Wirkungen. Er gab der Wehrmacht das Zeichen der moralischen Integrität. Diese unterstrichen Verantwortliche der Wehrmacht-Elite, als sie – die Generalfeldmarschälle Walther von Brauchitsch und Erich von Manstein, Generaloberst Franz Halder, die Generale Walter Warlimont sowie Siegfried Westphal – die berühmte „Denkschrift der Generale“ für den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess verfassten und feststellten, „dass das Heer gegen Partei und SS eingestellt gewesen sei, nahezu alle wichtigen Entscheidungen Hitlers missbilligt und gegen Kriegsverbrechen opponiert hatte.“
Von der deutschen Öffentlichkeit waren diese Aussagen lange Zeit für bare Münze genommen worden, hatte doch nahezu jede Familie Angehörige, die einst ihren Dienst in der Wehrmacht taten und von Verbrechen seitens der Wehrmacht nichts mitbekommen haben.
Heute ist das Verhalten der Öffentlichkeit nahezu gegenteilig. Es ist verrucht und nicht mehr erwünscht, sich vor den ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht zu verneigen. Eine einseitige Fixierung auf die Verbrechen der Wehrmacht (als Beispiel sei die Ausstellung von Reemtsma genannt), führte im Endeffekt zur Vertreibung des Denkmals aus Tübingen.
Die Geschichte dieses Tübinger Denkmals darf daher auch – um es nochmals zu wiederholen – als ein sehr treffendes Beispiel dafür verstanden werden, wie unterschiedlich die Kriegsgeneration und die nachfolgende Generation mit dem Gedenken umgehen. Einen Dialog zwischen den Generationen hat es leider selten gegeben. Dies war auch in Tübingen nicht anders.
Hätte es einen Dialog gegeben und wäre dieser fruchtbar gewesen, könnte das Denkmal in seiner alten Form und mit seiner alten Aufschrift noch stehen und daneben ein deutlicher Hinweis auf die begangenen Verbrechen. Die Denkmalverhüllung und erst recht die Zersägung der Tafel waren in der gleichen Weise einseitig, wie die jahrelange Aufrechterhaltung des Mythos der sauberen Wehrmacht.
Die Kinder und Kindeskinder der Veteranen neigten und neigen allzu schnell zu einer absoluten Verurteilung, während ehemalige Wehrmachtssoldaten zu einer Relativierung der Verbrechen ihrer Armee tendierten und tendieren. Im Hinblick auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre kann heute kein seriöser Historiker bestreiten, dass sich Teile der Wehrmacht mitschuldig gemacht haben an den Verbrechen im Osten. Gleichzeitig gab es aber auch eine Vielzahl von Soldaten, die erst nach dem Krieg von den Verbrechen erfahren haben und sich nie schuldig gemacht haben.
Letztendlich darf es als Verlust für Tübingen bezeichnet werden, dass der Stein des Anstoßes in Tübingen nicht mehr vorhanden ist, weil gerade er diesen Konflikt innerhalb unserer Gesellschaft so treffend präsentierte – zum einen – und zum anderen, weil ein solcher Stein mit eben der Aufschrift „Ihren toten und gefallenen Kameraden…“ auch an sich eine Mahnung vor Krieg, sowie ein Hinweis auf die Schrecklichkeiten eines Krieges, darstellt.
Literaturverzeichnis:
Assmann, A.: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitäten in frühen Hochkulturen, München 1992.
Assmann, A.: Gedächtnis, Erinnerung, in: Bergmann, K. (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Seelze-Velber 1997.
Baden-Württembergische 78. Infanterie- und Sturmdivision: 13. Treffen d. ehemaligen Angehörigen aus Anlass d. Divisionsaufstellung vor 50 Jahren ; 29. Aug. 1939 - 16. Sept. 1989.Ulm 1989.
Eschebach, I.: Öffentliches Gedenken. Deutsche Erinnerungskulturen seit der Weimarer Republik. Frankfurt 2005.
Kultermann, U.: Das Denkmal in unserer Zeit. in: Das Kunstwerk 12. 1958.
Jeismann, K.-E.: Geschichtsbewusstsein - Theorie, in: Bergmann, K. (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Seelze-Velber 1997.
Messerschmidt, M.: Vorwärtsverteidigung. Die „Denkschrift der Generale“ für den Nürnberger Gerichtshof, in: H. Heer, K. Naumann (Hg.), Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1945, Hamburg 1995.
Mittig, H.- E./Plagemann, V. (Hrsg.): Denkmäler im 19. Jahrhundert. Deutung und Kritik, München 1972.
Richter, Gert: Kitsch-Lexikon von A bis Z, Gütersloh 1972.
Riegl, A.: Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung, Wien 1903.
Rüggeberg, J.: Streit um ein Denkmal – Streit um das Gedenken, in: Geschichtswerkstatt 29, Erinnern gegen den Schlussstrich. Zum Umgang mit dem Nationalsozialismus. Tübingen 1997.
Thümmler, L.-H.: Der Wandel im Umgang mit den Kriegerdenkmälern in den östlichen Bundesländern Deutschlands seit 1990, in: Jahrbuch für Pädagogik 2003, Frankfurt/ Main 2003.
Wette, W.: Das Bild der Wehrmacht-Elite nach 1945, in: G. Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische Elite. Bd. 2: Vom Kriegsbeginn bis zum Weltkriegsende, Darmstadt 1998.

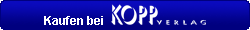
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Warum der Name Neckar-Alb? |
|
|
|
|
|
| |
Die Idee "Kulturwerke der Regionen" möchte einzelne Regionen in Deutschland in ihrer Vielgestaltigkeit und Vielschichtigkeit erlebbar machen. Letztendlich soll es an vielen Orten in Deutschland Kulturwerke geben. Weitere Ausführungen dazu sind bei unserer Dachorganisation "Kulturwerke Deutschland"' einzusehen.
Die Kulturwerkregionen sind nicht nach einem festen Schema, etwa nach politisch-administrativen Gebieten, benannt. Die Namen sind im Sinne einer groben räumlichen Einordnung zu verstehen.
Für den Namen unseres Kulturwerkes "Neckar-Alb" haben wir uns entschieden, weil der Neckar und die Alb unsere Region in mannigfaltiger Weise geprägt haben, prägen und prägen werden. Neckar und Alb bringen eine Menge an Assoziationen mit sich, die unsere Kulturwerkregion sehr gut beschreiben können. Demzufolge machen wir vor Landkreisgrenzen nicht halt und sind auch außerhalb der Landkreise Balingen (Zollernalbkreis), Reutlingen, Tübingen (die Landkreise der politisch-administrativen "Region Neckar-Alb") aktiv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
interne Suchmaschine |
|
|
|
|
246253 Besucher (detaillierter unter Transparenz) |